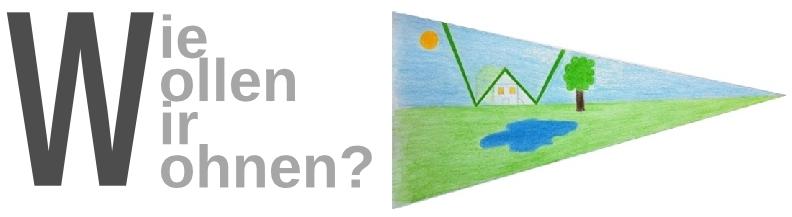Doch nicht so normal?!
Seit der Konfrontation mit der Frage nach Normalität ist einige Zeit vergangen, und offensichtlich werden wir von anderen als nicht so normal wahrgenommen wie Dirks Eintrag vermuten lässt. Wie kann das sein? Ein erneuter Blick auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes bringt Licht ins Dunkel:
Die Statistik
Die Darstellung der Zahlen von Dirk ist zwar korrekt: Wir gehören ab Dezember zu den 52% Paaren mit Kindern unter 18 Jahren, bei denen beide Elternteile arbeiten. Berücksichtigen wir hier jedoch den Umstand, dass unsere Jüngste noch keine drei Jahre alt ist und betrachten die Zahlen zur Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern dieses Alters stehen wir in Westdeutschland vor folgender Tatsache: nur 28,7% aller Mütter sind hier erwerbstätig, davon 75,6% in Teilzeit. Das heisst, dass noch nicht einmal jede vierte Mutter von diesen nicht mal 30% aller Mütter mit Kindern unter drei Jahren vollzeiterwerbstätig ist. Oder andersherum: Nur 7% der Mütter mit Nachwuchs im Alter von bis zu drei Jahren arbeiten in Vollzeit. Es ist also ganz augenscheinlich „unnormal“ als Frau in dieser Situation eine Vollzeitstelle zu besetzen.
Weiterhin sind zwar bei 52% der Paare beide Elternteile erwerbstätig, jedoch nur bei 22% beide in Vollzeit.
Dirk ist in seinem Text nicht auf unseren Bildungsstand eingegangen. Wir haben beide Abitur und gehören somit im Bezug auf die schulische Ausbildung mit 25,8% zur zweitgrößten Gruppe im Jahr 2010, hinter 37% mit Volks-/Hauptschulabschluss und vor 21,7% mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss.
Im Bezug auf den beruflichen Bildungsabschluss gehören wir mit 7,5% bzw. 5,0% jedoch zur Minderheit der Bevölkerung. Auch hier könnte man zu dem Schluss kommen, wir seien nicht „normal“.
Das Durchschittsalter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes beträgt 28,9 Jahre- ich war bei der Geburt meines ersten Kindes 24, beim zweiten 27 Jahre alt und somit zu jung um der Norm Genüge zu tun.
Die „normale“ Wohnform
Wenn wir die beiden „Normalo-Alternativen“ kleines Einfamilienhaus vs. Wohnung nach Standard des sozialen Wohnungsbaus betrachten, bleibt festzuhalten, dass wir momentan letztere für uns gewählt haben. Warum wohnt eine offensichtlich nicht ganz normale Familie in einer Wohnung für ganz normale Familien? Ist es unser Traum so zu wohnen? Anscheinend nicht, denn sonst würde ich mir die Frage „Wie wollen wir wohnen?“ auf diese Art und Weise gar nicht stellen.
Käme die sprichwörtliche „Gute Fee“ vorbeigeflattert um mir meinen Wohnwunsch zu erfüllen, dann würde ich meine Worte jedenfalls sehr sorgfältig wählen. Denn wie in Urlaubskatalogen die Beschreibung „gute Verkehrsanbindung“ durchaus nicht selten mit „direkt in der Einflugschneise des Flughafens“ übersetzt werden kann, muss man auch beim Wünschen eine gewisse Vorsicht walten lassen. Ich spreche da aus Erfahrung. Was würde ich der Guten Fee also sagen?
Dass ich gern mindestens vierzig Quadratmeter mehr hätte, die jedoch gut und sinnvoll verteilt sein sollten. Die Bäder sollen bitte jeweils mit einem Fenster ausgestattet sein, so wie selbstverständlich alle anderen Räume der Wohnung auch. Der Balkon bitte doppelt so groß oder gleich im Erdgeschoss/Hochpaterre mit kleinem Garten oder Zugang zu einem von vielen netten Menschen genutzten „Innenhof“. Küche und Schlafzimmer sollten bitte so angeordnet sein, dass Essensgerüche nicht die süßen Träume stören und Schlaf- und Wohnzimmer so weit auseinanderliegen, dass auch wenn im Wohnzimmer noch geklönt wird, selbst leichte Schläfer schlafen können. Ein Zimmer mehr wäre auch wünschenswert, ebenso ein gutes Raumklima, schimmelfreie Räume und ordentlich isolierte Wände. Die Wohnung sollte gut an das Netz des ÖPNV angeschlossen und auch mit dem Auto gut erreichbar sein und gleichzeitig nicht an einer Hauptverkehrsstraße liegen. Einkäufe sollten bitte zu Fuß erledigt werden können, ebenso soll der Weg zwischen Wohnung und (ansprechender!) Gastronomie auch mit dem einen oder anderen Gläschen hinter der Binde auf zwei Beinen zurückgelegt werden können. Ach ja: in Hamburg liegen und bezahlbar sein soll das Ganze selbstverständlich auch. Und mit „in Hamburg“ meine ich hier im Übrigen nicht den Großraum Hamburg, sondern den Raum östlich der A7, (deutlich) westlich der A1, südlich des Flughafens und nördlich der Elbe.
Ich hoffe, meine Gute Fee muss jetzt nicht zum Treffen der Anonymen Guten Feen mit unerfüllbarem Wohnungswunsch gehen, aber eine Wohnung in der Art wäre schon recht schön.